Das Druidentor
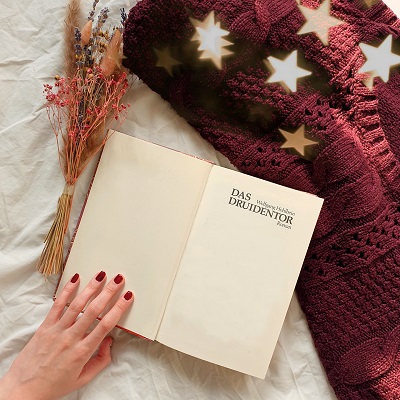
Ein verfluchter Eisenbahntunnel
Meine Januar-Rezension 2025
Als Kind hat mein Vater mir einmal eine Gruselgeschichte erzählt. Sie handelte von einer Familie, die an einem Bahnhof auf die Rückkehr des Vaters von einer Geschäftsreise wartete. Doch der Zug kam nie an. Auch das Bahnunternehmen hatte den Kontakt zum ICE in einem Bergtunnel verloren. Als die Polizei Stunden später den Tunnel sperrt, um nach dem Zug zu suchen, finden sie ihn schrottreif und verrostet auf einem Gleis. Alle Insassen sind tot, scheinbar verdurstet und bereits mumifiziert, als wäre der ICE Jahrhunderte lang in einer Zeitschleife gefangen gewesen, während außerhalb des Tunnels nur wenige Stunden vergangen sind. Mein Vater hat dann gesagt, dass diese Geschichte auf einem Buch von Wolfgang Hohlbein basiert: „Das Druidentor“. Ich konnte diesen Plot nie wirklich vergessen und habe mich immer gefragt, wie es weitergeht. Eines Tages habe ich dann eine sehr abgenutzte Ausgabe dieses Mysterythrillers in einem Bücherschrank entdeckt und direkt mitgenommen. „Das Druidentor“ erschien 1993 und gilt als eines der erfolgreichsten Bücher des deutschen Autors.
Inhalt
Um den ständigen Stau und zähfließenden Verkehr auf den Routen nach Italien entgegenzuwirken, baut die Schweiz Anfang der 1990er einen Eisenbahntunnel durch das Gebirgsmassiv Gridone oberhalb des Touristenorts Ascona. Bereits während des Tunnelbaus ereignen sich merkwürdige Dinge, so geht bspw. ein Bautrupp mit 25 Männern plötzlich verloren und taucht später unter mysteriösen Umständen wieder auf. Doch die eigentliche Katastrophe ereignet sich drei Jahre später, als ein ICE in den Tunnel fährt, aber nicht mehr heraus kommt. Die Rettungskräfte finden einen völlig schrottreifen Zug vor, in dem alle dreißig Insassen verhungert, verdurstet oder ermordet wurden. Die ratlosen Behörden sprechen in den Medien von einem Terroranschlag, doch Kommissar Veith Rogler von der Kantonspolizei Tessin sowie der ehemalige Vermessungsingenieur des Tunnelbaus Frank Warstein versuchen, dem übernatürlichen Geheimnis auf den Grund zu gehen.
Cover
Da das Buch inzwischen mehr als 30 Jahre alt ist, hat es viele verschiedene Cover gehabt, die im Kern aber viele Gemeinsamkeiten haben. Viele Cover zeigen einen felsigen Tunnel, an dessen Ende entweder eine oder mehrere Silhouetten von Menschen erkennbar sind oder Licht bzw. Lichtpunkte zu sehen sind. Das Farbschema der meisten Cover bewegt sich zwischen Blau bis Schwarz, teilweise auch mit ein wenig Grün darin. Die aktuelleren Cover zeigen eher verschnörkelte und verschlungene Tribals, die von der Abbildung des Tunnels immer mehr weggehen. Bei meiner abgewetzten Hardcover-Ausgabe gab es nicht einmal mehr einen Schutzumschlag, weshalb ich nur vermuten kann, was das ursprüngliche Cover war. Jedenfalls hat mich die Prämisse des Plots bei „Das Druidentor“ deutlich mehr überzeugt als dessen Cover.
Kritik
„Im Inneren des Gridone.“, ist der erste, knappe Satz des ersten Kapitels. Ich wusste es vor diesem Buch gar nicht, aber der Gridone ist ein Berg in den Tessiner Alpen, dessen Gipfel auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz liegt. Mit seinen 2186m über dem Meeresspiegel und seiner Nähe zum Laggo Maggiore ist der Berg im Winter auch bei Skitouristen beliebt. Dass der erste Satz den Fokus auf den Schweizer Berg legt, ist nicht weiter verwunderlich, da der darin liegende Zugtunnel Dreh- und Angelpunkt des gesamten Mysterythrillers ist. „Das Druidentor“ hat bei fast 550 Seiten gerade einmal 19 Kapitel. Die Erzählung ist nicht linear, sondern beinhaltet teilweise Zeitsprünge, die manchmal etwas verwirrend sein können.
Der größere Protagonist des Romans ist der 37-Jährige Ingenieur Frank Warstein, der mit seinem selbst entwickelten Vermessungslaser eine der führenden Kräfte des Tunnelbaus war, bis er versucht hat, die unheimlichen Geheimnisse des Gridone zu lüften. Da er zu viele Fragen gestellt hat, wurde er seinem Vorgesetzten Dr. Franke zu unangenehm, woraufhin er gefeuert wurde. Der plötzliche Jobverlust gepaart mit den geradezu traumatisierenden Ereignissen während des Tunnelbaus, die Warstein nicht richtig zuordnen kann, ruinieren seine Existenz. Als inzwischen alkoholkranker Arbeitsloser fristet er nun ein trauriges Leben in seiner unordentlichen Mietwohnung mit seinem Kater Vlad, wobei er oft nicht einmal weiß, welcher Wochentag ist. Erst der Besuch von Angelika Berger, die ihn flehend bittet, ihr bei ihrer Suche nach ihrem im Tunnel verschollenen Mann zu helfen, rüttelt Warstein auf. Frank Warstein verkörpert viele Widersprüche. Er ist einerseits ein ungepflegter Alkoholiker, andererseits ein überaus intelligenter und gebildeter Ingenieur, der technische Innovationen entwickelt hat. Er ist sowohl pragmatisch und logisch veranlagt, als auch impulsiv und jähzornig. Gleichzeitig verkörpert er den Konflikt des Lesers, die rational nicht erklärbaren Vorkommnisse mit mystischen oder übernatürlichen Ursachen zu begründen. Kurzum, Warstein ist in gewisser Weise ein Antiheld, der im Verlauf der Geschichte mit seinen eigenen Ängsten und Zweifeln konfrontiert wird.
Hohlbein bedient sich einer einfachen, zugänglichen, manchmal auch eher flachen Sprache. Der Autor hat mehr als 200 Bücher veröffentlicht, und auch wenn der Schreibstil nicht unbedingt schlecht ist, merkt man ihm doch an, dass über manche Sätze nicht zwei Mal nachgedacht wurde. Als Beispiel dafür habe ich folgenden Satz gewählt: „Der Grund dafür, dass Salieri trotz seiner Abneigung gegen Wasser und alles, was damit zu tun hatte, jetzt im Heck eines winzigen, schaukelnden Motorboots saß, die heraufziehenden Wolken betrachtete, gleichzeitig mit einem Teil seiner Konzentration gegen die leichte Übelkeit ankämpfte, die sich gleich nach Beginn der Fahrt in seinem Magen ausgebreitet hatte, und trotzdem rundum zufrieden und so glücklich wie selten zuvor im Leben war, hieß Mariella, war siebenundzwanzig Jahre alt und hatte schwarzes, schwarze Augen und eine geradezu traumhafte Figur, die nicht einmal das gelbe Ölzeug, das sie gerade anzuziehen im Begriff war, vollends verbergen konnte.“ (S. 134). Das ist ein wirklich nicht besonders geschickt formulierter Bandwurmsatz, der so ambig ist, dass ich absolut nachvollziehen kann, wenn man hier den Faden verliert. Der Schachtelsatz stellt ja schon fast Thomas Mann in den Schatten. Er beinhaltet zu viele nebensächliche Informationen und hätte entweder gekürzt oder aufgetrennt werden sollen.
Doch das ist nicht der einzige sprachliche Kritikpunkt, denn mir sind einige Fehler bzw. Formulierungen aufgefallen, die mindestens als kritisch zu bewerten sind. So betrachtet Warstein an einer Stelle seinen Kater Vlad und denkt darüber nach, „woher Levis die Inspiration für seine Grinsekatze genommen hatte“ (S. 30). Darüber bin ich hart gestolpert, denn erst bei der „Grinsekatze“ hatte ich verstanden, dass es hier eine Anspielung auf „Alice im Wunderland“ sein soll. Der Autor hieß nämlich Lewis Carroll, wobei hier einerseits Lewis falsch geschrieben ist, andererseits aber auch so formuliert, als sei „Levis“ der Nachname. Also hier zum Mitschreiben: Carroll schrieb Alice, Levis produziert Jeans. Auch die Bezeichnung Schwarzer als „Farbige“ (S. 129) gilt als veraltet und wird heutzutage als problematisch gesehen, da der Begriff koloniale Wurzeln hat. Dass diese Männer als „reinrassige Afrikaner“ (S. 129) bezeichnet werden, macht es nicht besser, da der Terminus „Rasse“ wissenschaftlich nicht haltbar ist. „Reinrassigkeit“ impliziert, dass es reine und unreine Menschen gäbe, wodurch rassistische Ideologien untermauert werden könnten. Außerdem findet sich das N-Wort auf S. 269, und ich muss wohl nicht erwähnen, dass dies ein sehr diskriminierender Begriff für Schwarze ist. Ich werfe Hohlbein hier keine böse Absicht vor, vielmehr zeigt diese Passage, dass der Roman in vielerlei Hinsicht veraltet ist und ein gesellschaftliches Bild der 1990er widerspiegelt, in dem antirassistisches Denken noch nicht wirklich etabliert war. Auch an anderen Aspekten fällt auf, dass die Geschichte vor über 30 Jahren spielt, und dass sich seitdem viel verändert hat. So wird im Roman noch mit der Deutschen Mark bezahlt, im Flugzeug darf noch geraucht werden und Warstein träumt davon, die Erfindung des Bildtelefons miterleben zu dürfen, während heutzutage Apps wie Skype, Zoom, Facetime oder Whatsapp für Videotelefonate völlig selbstverständlich sind.
Insgesamt überzeugt „Das Druidentor“ mit einer starken ersten Hälfte, wobei der Spannungsbogen im Verlauf immer mehr abflacht. Das liegt auch daran, dass hier immer wieder schwer nachvollziehbare Zeitsprünge gemacht werden, die nicht näher kontextualisiert werden, bspw. mit einer Unterüberschrift oder ähnlichem. Außerdem hatte ich eine andere Erwartungshaltung an diesen Mysterythriller. Zum Beispiel hatte ich gehofft, einen Erzählstrang über die Insassen des ICE lesen zu können, die plötzlich in einer Zeitschleife gefangen sind und nicht mehr aus dem Berg befreien können. Stattdessen ist es bloß ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Protagonisten und Antagonist. Die Auflösung geschieht schrittweise in der zweiten Hälfte und lässt mich auf eine gewisse Weise befriedigt zurück, weil ich nun endlich weiß, was die mysteriösen Ereignisse ausgelöst hat. Die Moral ist für mich, dass es stets risikobehaftet ist, wenn der Mensch in natürliche Gebiete eindringt, um die Umwelt nach seinem Gutdünken verändern. Einen gewissen Respekt vor der Natur darf die Menschheit niemals verlieren.
Fazit
„Das Druidentor“ von Wolfgang Hohlbein lockt mit einer vielversprechenden Prämisse und bietet einen spannenden Einstieg, verliert im weiteren Verlauf jedoch an Struktur und Nachvollziehbarkeit. Die Handlung wirkt mit ihren wilden Zeitsprüngen sehr willkürlich, während die Figuren zwar Potenzial haben, aber oft in Klischees verhaftet bleiben. Ich habe mich in der zweiten Hälfte dabei erwischt, wie ich die Geschichte nur noch überflogen anstatt aufmerksam gelesen habe. Hohlbeins Schreibstil ist zwar einfach, aber teilweise unnötig verschachtelt und meiner Ansicht nach bestenfalls mittelmäßig. Die problematischen Formulierungen und veralteten Begriffe zeigen, dass der Thriller ähnlich wie der ICE im Gridone leider schlecht gealtert ist. Auch wenn die Auflösung befriedigend war, hinterlässt das Werk einen eher durchschnittlichen Eindruck. Deswegen kann ich dem Buch nicht mehr als zwei von fünf Federn geben. Hohlbein hat inzwischen schon mehr als 200 Bücher publiziert. Vielleicht ist eine gewisse Unausgereiftheit dabei ja unvermeidlich. Vorerst werde ich keine weiteren Bücher von ihm lesen.

Danke für deinen tolle Rezension.
LG Otti
Ooooh, vielen Dank für deinen lieben Kommentar 🥰 Liebe Grüße!